Wie heiß wird es in Freiburg in 50 Jahren sein? Das soll ein neues KI-Modell der Universität Freiburg und des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) berechnen können. Am Beispiel von Freiburg simulierten die Forschenden auf den Quadratmeter genau drei verschiedene Klimaszenarien für den Zeitraum von 2070 bis 2099. Ferdinand Briegel ist Postdoc am Institut für Meteorologie und Klimatologie des KIT und hat am Projekt mitgearbeitet. Er berichtet, welche Erkenntnisse sich daraus für die Stadtplanung ableiten lassen.
Welche drei Szenarien zeigt das Modell auf und welches davon ist das Wahrscheinlichste?
Ferdinand Briegel: Das Modell zeigt die Szenarien RCP2.5, RCP4.5 und RCP8.5, die als RCP (Representative Concentration Pathways) bezeichnet werden. Dabei handelt es sich um Klimaszenarien, die beschreiben, wie stark sich die Erde je nach zukünftigen Treibhausgasemissionen erwärmt. Welches Szenario eintritt, hängt natürlich auch vom globalen Willen zum Klimaschutz ab, weshalb eine Vorhersage schwer zu treffen ist. Wahrscheinlich wird es irgendwo zwischen RCP4.5 und RCP8.5 liegen.
Welche Faktoren fließen bei der Berechnung mit ein?
Briegel: Zu den meteorologischen Faktoren zählen beispielsweise Lufttemperatur, Feuchte, Strahlung und Windgeschwindigkeit. Darüber hinaus werden 3D-Daten zur Bebauung und Vegetation berücksichtigt.
An welchen Orten in der Stadt wird die Temperatur voraussichtlich besonders steigen?
Briegel: Zunächst muss klargestellt werden, dass wir die gefühlte Temperatur berechnen. In diese Berechnung fließen neben der Lufttemperatur auch deren Feuchte, die Windgeschwindigkeit sowie die Strahlung – also ob ein Punkt beschattet oder in der Sonne ist – ein. Zudem muss zwischen Tag und Nacht unterschieden werden. Viele Prozesse, die tagsüber für Beschattung und Abkühlung sorgen, hindern nachts die Wärme zu entweichen. Tagsüber sind vor allem freie, asphaltierte Flächen betroffen, das heißt vor allem Industriegebiete. Nachts sind es hauptsächlich dicht bebaute Gegenden mit großem Baumbestand. In diesen Gebieten ist die Durchlüftung geringer und Gebäude und Bäume verhindern, dass die Oberflächen abstrahlen. Dadurch wird die Hitze zurückgehalten. Das ist ein ähnlicher Effekt wie bei klaren Nächten, die kälter sein können als bewölkte Nächte.
Kann das Modell auch auf andere Städte angewandt werden – und wenn ja, wie steht Freiburg im Vergleich da?
Briegel: Um das Modell auf andere Städte anzuwenden, muss es zunächst an die dort vorherrschenden baulichen Gegebenheiten angepasst werden. In Freiburg gibt es beispielsweise keine Hochhäuser, wie sie in Frankfurt zu finden sind. Hier müsste das Modell zunächst getestet werden. Generell kann man zu Freiburg sagen, dass es aufgrund seiner Lage im Oberrheingraben zu den wärmeren Städten Deutschlands gehört. Aufgrund seiner Lage am Fuße des Schwarzwaldes ist Freiburg zudem begünstigt (also kühler) im Vergleich zu anderen Städten im Oberrheingraben, was sowohl die Tagesmaxima als auch die nächtlichen Temperaturen angeht. Die Stadt ist im Vergleich zu anderen Städten in ganz Deutschland bereits sehr grün und bietet viele „kühle“ Orte innerhalb der Stadt.
Wie können Städte im Bezug auf Klimaanpassung mit dem Modell arbeiten?
Briegel: In erster Linie ist dieses Forschungsprojekt ein Versuch, Klimaprojektionen auf Gebäude- und Straßenebene runterzuskalieren. Wir konnten zeigen, dass dies möglich ist. In Zukunft werden dazu sicherlich auch Anwendungen entstehen, die allerdings nicht von uns erstellt werden können, da der Fokus unserer Arbeit auf genau solchen Forschungsvorhaben liegt. Aufgrund von Rechenintensität und Ressourcenverbrauch war es bisher nicht möglich, mit klassischen physikalisch-numerischen Modellen solch lange Zeiträume für ganze Städte zu simulieren. Das konnte nun mit Hilfe von KI geschafft werden.
Info: Das KI-Modell hat drei Szenarios für den Zeitraum 2070 bis 2099 entwickelt. So wären unter dem pessimistischsten Szenario pro Jahr tagsüber bis zu 307 Stunden mit starker Hitzebelastung über 32 °C gefühlter Temperatur möglich. In der Referenzperiode zwischen 1990 bis 2019 waren es 135 jährlich. Die Stundenanzahl mit sehr starker Hitzebelastung über 38 °C gefühlter Temperatur könnte sogar um das Zehnfache steigen: auf 71 Stunden pro Jahr im Zeitraum 2070 bis 2099, verglichen mit sieben Stunden jährlich in der Referenzperiode. Im Vergleich steigen im Szenario mit der geringsten Erwärmungsentwicklung die Stunden unter starker Hitzebelastung auf jährlich 149 an. Die Anzahl der Stunden mit sehr starker Hitzebelastung beläuft sich in diesem Szenario auf zwölf Stunden.

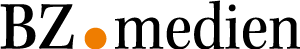

 Am Beispiel von Freiburg simulierten die Forschenden auf den Quadratmeter genau drei verschiedene Klimaszenarien für den Zeitraum von 2070 bis 2099. Foto: Stock.Adobe
Am Beispiel von Freiburg simulierten die Forschenden auf den Quadratmeter genau drei verschiedene Klimaszenarien für den Zeitraum von 2070 bis 2099. Foto: Stock.Adobe 

