Über 11.500 Läuferinnen und Läufer haben sich bereits für einen der fünf Läufe des diesjährigen Freiburg-Marathon am Sonntag, 7. April registriert. Wer ebenfalls teilnehmen möchte, sollte schnell sein: Anmeldungen sind noch bis zum Montag, 25. März 2024 über die Marathon-Webseite unter www.mein-freiburgmarathon.de/anmeldung möglich. Online nachmelden kann man sich bis zum 5. April, sofern dann noch Startplätze verfügbar sind.
Der Freiburg-Marathon umfasst fünf verschiedene Strecken: Neben Marathon (42,195 km) und Halbmarathon (21,0975 km) gibt es die Marathonstaffel, bei der sich vier Läufer die Marathonstrecke teilen. Zur Wahl stehen außerdem ein 10-Kilometerlauf sowie der Schülermarathon.
Zudem können alle Kinder der Jahrgänge 2014 bis 2022 beim beliebten Füchsle-Mini-Marathon am Samstag, 6. April 2024 starten – die Kleinen laufen hier kürzere Distanzen von etwa 400 bis 1.100 Meter direkt auf dem Gelände der Messe Freiburg, wo am Marathon-Sonntag auch der Start und Ziel ist. Organisiert wird der inzwischen 19. Freiburg-Marathon von der Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH (FWTM) und dem Badischen Leichtathletik-Verband e.V. (BLV).
Information und Anmeldung unter www.mein-freiburgmarathon.de
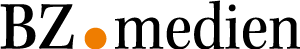

 Der Freiburg-Marathon zählt zu den Sport-Highlight des Jahres in der Stadt – am 7. April ist Startschuss für die 19. Auflage. Foto: Joers
Der Freiburg-Marathon zählt zu den Sport-Highlight des Jahres in der Stadt – am 7. April ist Startschuss für die 19. Auflage. Foto: Joers 

